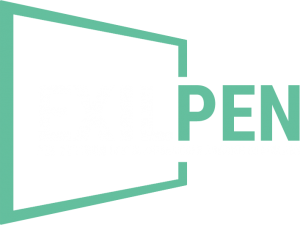Tage des Exils – Rede von Herta Müller
TAGE DES EXILS – Rede von Herta Müller
Herta Müller eröffnete als Schirmherrin der ersten Berliner „Tage des Exils“ das vierwöchige Veranstaltungsprogramm mit der „Rede zum Exil“ bei der Auftaktveranstaltung in der Akademie der Künste.
Die Tür war die erste Haut, die aufgerissen wurde
Herta Müller
Der Künstler Gunter Demnig hat seit 1992 über 80.000 Stolpersteine verlegt. Es sind die kleinsten Erinnerungsorte, Gedächtnisflecken am Wegrand. Nicht größer als das Innere einer Hand. Man kann darauf meist den Namen eines von den Nazis Ermordeten lesen und ganz selten das Wort Flucht nach England oder Palästina.
Aber als Demnig vor einigen Jahren für den ins Exil nach England geflohenen Walter Sochaczewski einen Stolperstein verlegen wollte, lehnte die Stadt Hannover das ab. Der Grund dafür war: Der jüdische Kinderarzt sei doch bereits 1936 emigriert. Er habe den Holocaust ja überlebt und sei kein Opfer des Nationalsozialismus, an das mit einem Stolperstein erinnert werden sollte.
Seit 1945 gelten die ins Exil vertriebenen Deutschen als „entkommen“ oder „gerettet“, also nicht als Opfer. So soll Exil, wenn auch nicht deutlich ausgesprochen, als das Gegenteil von Opfer verstanden werden. Denn als Opfer des Krieges fühlten sich ja die Deutschen in ihren zerbombten Städten. Den Geflohenen warf man vor, sie hätten sich im Ausland ein leichtes Leben gemacht. Willy Brandt wurde im Wahlkampf verhöhnt: „Eines wird man Herrn Brandt doch fragen dürfen, was haben Sie zwölf Jahre draußen gemacht? Wir wissen, was wir drinnen gemacht haben.“
Willy Brandt hatte im norwegischen Exil Widerstand gegen die Nazis geleistet. Er hieß eigentlich Herbert Frahm. Er behielt als Zurückgekehrter seinen Exilnamen, weil das Exil die Person aus ihm gemacht hatte, die wir als Willy Brandt kennen. Er trug das Exil buchstäblich an seinem Körper. Er zeigte mit diesem Exilnamen: Genauso wie Bundeskanzler bin ich ein Heimgekehrter aus dem Exil.
Wieviel, besser gesagt, wie wenig weiß man über den Widerstand im Exil? Zum Beispiel über die 20.000 Emigranten aus Deutschland, die sich wie Georg Stefan Troller, Klaus Mann, Hans Habe oder Ulrich Biel in den USA den amerikanischen Streitkräften angeschlossen haben, um gegen die Nazis zu kämpfen? Oder Stefan Heym, der auch seinen Exilnamen behalten hat und eigentlich Helmut Flieg hieß. Er war einer der Ritchie Boys, Soldaten, die in Amerika in psychologischer Kriegsführung ausgebildet wurden, um deutsche Soldaten mit Lautsprechern und mit Flugblättern zur Kapitulation aufzufordern. An vorderster Frontlinie eingesetzt, waren sie leichte Ziele für die Nazi-Artillerie.
Neben den kleinsten Erinnerungsorten, den Stolpersteinen, erinnern in Berlin nur noch die etwas größeren Porzellantafeln an Hausfassaden manchmal an die Flucht ins Exil. Sie sind schneeweiß wie eine Serviette, die man im Dialekt Mundtuch nennt.
Für Nelly Sachs hängt in der Lessingstraße eine dieser Tafeln. Darauf steht, dass sie „hier seit ihrer Kindheit“ lebte und „1940 nach Stockholm emigrierte“.
Das ist zum einen etwas Falsches und zum anderen etwas Richtiges, das dennoch falsch ist.
Denn Nelly Sachs wurde weder in der Lessingstraße geboren, noch lebte sie bis zu ihrem Exil dort. Ihr Geburtshaus steht in der Maaßenstraße 15 in Schöneberg. Zwei Jahre später zog die Familie für einige Jahre in die Lessingstraße und wieder 15 Jahre später in eine großbürgerliche Wohnung mit Salons und Springbrunnen im Garten. Die Familie war in ganz Berlin als die „Gummi-Sachse“ bekannt, sie hatte eine Gummiwarenhandlung am vornehmen Dönhoff-Platz. Nach dem frühen Tod des Vaters konnten sich die Mutter und Nelly Sachs diese Wohnung nicht mehr leisten. Sie mieteten eine kleine Wohnung bis es verboten wurde, Wohnungen an Juden zu vermieten. Sie fanden ein möbliertes Zimmer bei der jüdischen Witwe Hedwig Rosenheim in der Mommsenstraße 22. Danach in der Pension Schwalbe in der Mommsenstraße 55. Allein aus diesem Haus wurden 25 Juden in die Vernichtungslager deportiert. Die Inhaber der Pension Alfred und Nelly Schwalbe nahmen sich selbst das Leben, um der Deportation zu entgehen.
Nelly Sachs lebte seit 1933 mit dem Koffer in der Hand 7 Jahre lang in ständiger Verfolgung und Todesangst und versuchte aus Deutschland zu entkommen.
Sehr spät, erst 1940, da war Nelly Sachs 48 Jahre alt, gelang ihr und der Mutter die Flucht nach Schweden – und zwar mit Hilfe von Selma Lagerlöf, an die Nelly Sachs schon als Jugendliche ihre Gedichte geschickt hatte. Nur einen Tag vor der schon angeordneten Deportation traf das schwedische Visum ein. „Ich hatte das Glück seit meiner Jugend mit Selma Lagerlöf im Briefwechsel zu stehen. Im Frühjahr 1940, nach qualvoller Zeit, trafen wir in Stockholm ein. Die Besetzung Dänemarks und Norwegens war schon geschehen. Ohne die Sprache zu verstehen oder einen Menschen zu kennen, atmeten wir die Freiheit ein.“ – so Nelly Sachs in ihrer Rede zur Nobelpreisverleihung 1966. Selma Lagerlöff war kurz vor ihrer Ankunft gestorben.
In dem Text „Leben unter Bedrohung“ beschreibt sie die ständige Todesangst der sieben Nazijahre in Berlin. „Zeit unter Diktat. Wer diktiert? Alle! Mit Ausnahme derer, die auf dem Rücken liegen wie der Käfer vor dem Tod. … Es kamen Schritte. Starke Schritte. … Schritte stießen an die Tür. Sofort sagten sie, die Zeit gehört uns! … Die Tür war die erste Haut, die aufgerissen wurde. Die Haut des Heims.“
Nelly Sachs hat ab dem ersten Tag in Schweden alles versucht, den Schrecken hinter sich zu lassen. Sie hat sehr schnell Schwedisch gelernt. Ihre Gedichte veränderten sich durch den Einfluss der modernen schwedischen Lyrik. Sie begann, schwedische Lyrik ins deutsche zu übersetzen. Hilde Domin schreibt: „Jeder, der das Exil mitgemacht hat, versteht sofort die intime Identifikation, die aus der Verbindung beider Sprachen entstand: Der des verlorenen Zuhauses und es Landes ihrer Zuflucht. Da wird etwas hergestellt, das Fremdheit mildert und dem Menschen einen Ort gibt, der keinen mehr hat. … Sie ist daher Exildichterin nicht nur in dem Sinne, dass sie das Exil erlitt und thematisierte. Sondern dass das Exil ihr buchstäblich zur künstlerischen Neugeburt wurde.“
Nelly Sachs hat Nazideutschland mit den Füssen verlassen und im Kopf mitgenommen. Und der Schrecken verlängerte sich. Nicht nur der eigene. Denn ab 1943 kamen die grauenhaften Nachrichten über die Vernichtungslager, den Abtransport in den Tod.
In Stockholm lebte Nelly Sachs zusammen mit ihrer Mutter in der dritten Etage einer nur 40 qm kleinen Wohnung in einem Haus, das der Warburg-Stiftung gehörte und fast ganz von deutsch-jüdischen Flüchtlingen bewohnt war. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete sie als Wäscherin und Übersetzerin. Als die Mutter starb, verlor sie vollends den inneren Halt. Der Verfolgungswahn meldete sich rabiat. Sie fühlte sich von den Nazis umzingelt. In einem Text in schwedischer Sprache schreibt sie schon 1960: „Seit etwa einem Jahr hört man in der Küche am Wasserhahn ein schneidendes Geräusch. Es konnte nicht lokalisiert werden, ob es über oder unter meiner Wohnung war. Aber man hatte nicht den Eindruck, dass es mit täglicher Hausarbeit zu tun hatte. … Konnte ein derart organisierter Lärm Zufall sein? … Eine Werkstatt hat sich oberhalb meiner Wohnung eingenistet. … Das schlimmste daran ist, dass so viele Menschen darin verwickelt sind und ich ganz und gar hilflos bin. Eine Hitlersammlung im Kleinen und ungeheure Feigheit.“ Nelly Sachs hört überall im Haus Morsezeichen einer nationalsozialistischen Kommandozentrale. Sie geht nur noch mit Kopftuch und Ohrstöpseln durch die Straßen und sieht in den roten Ampeln Blut. Und sie kommt jetzt immer wieder in psychiatrische Behandlung. Auch in geschlossene Abteilungen. In diesen Zeiten schreibt Nelly Sachs ihre Gedichte über die Verfolgung in Berlin. Es scheint, als halte das Schreiben sie am Leben.
SO RANN ICH aus dem Wort:
jetzt ist es spät.
das Leichte geht aus mir
und auch das Schwere
die Schultern fahren schon
wie Wolken fort
Arme und Hände
ohne Traggebärde
Tiefdunkel ist des Heimwehs Farbe immer
so nimmt die Nacht
mich wieder in Besitz.
Aris Fioretos meint, das Schreiben sei für Nelly Sachs eine „Linderung, die sie gleichzeitig bedrohte.“ Wenn man diesen Satz liest, denkt man nicht zufällig sofort an Paul Celan. Denn Nelly Sachs und Paul Celan verband eine lebenslange enge Freundschaft. Es war ein Aufeinander-angewiesen-sein zweier Verlorener, die gequält wurden von der Erinnerung an die Vernichtung der Juden. Und es war eine bedingungslose Nähe, eine dunkle abgründige Gemeinsamkeit.
In einer ihrer schweren Krisen schickt Nelly Sachs ein Telegramm nach Paris zu Celan mit der Bitte, zu ihr ins Krankenhaus zu kommen. Und Celan kommt. Aber Nelly Sachs ist zu tief verwirrt. Sie empfängt ihn nicht, weil sie ihn nicht erkennt.
Beider Texte sind zwar völlig verschieden, treffen sich aber dennoch – man möchte fast sagen – seelisch. Der Stil von Nelly Sachs ist ekstatisch, eine außer-sich-geratene Sprache. Hilde Domin schreibt: „Der Ekstatiker hat das Gedicht nicht in der Hand, eher umgekehrt. … Nie ist das Gedicht bei ihm ein Machen, immer ein Tun, bei dem er aber dahingerissen ist. … Celan zum Beispiel ist im Vergleich zu ihr ein Macher, ein Artist. Was keine Bewertung sein soll.“
In den Briefen teilen die beiden nicht nur ihre Sorgen umeinander, sondern auch ihre neuen Gedichte. In einem Brief an Celan steht das Gedicht:
Wer ruft?
Die eigene Stimme!
Wer antwortet?
Tod!
Geht die Freundschaft unter
im Heerlager des Schlafes?
Ja!
…
Was ist das?
Schlaf und Sterben sind eigenschaftslos
Und dann geht das Gedicht über in den Brief:
„Paul, bevor ich in zwei Tagen in die Wohnung zurückkehre — auf Versuch – ob ich wieder in Freiheit leben darf – noch diesen Gruß aus dem Krankenhaus – und Segenswunsch für Euch drei – meine geliebte Familie.“
Und im Gedichtzyklus „Glühende Rätsel“ schreibt sie über ihre Krankheit:
1
Diese Nacht
ging ich in eine dunkle Nebenstraße
um die Ecke
Da legte sich mein Schatten
in meinen Arm
Dieses ermüdete Kleidungsstück
wollte getragen werden
und die Farbe Nichts sprach mich an:
Du bist jenseits!
2
Auf und ab gehe ich
in der Stubenwärme
Die Irren im Korridor kreischen
mit den schwarzen Vögeln draußen
um die Zukunft
16
Wenn ich die Stube beschützt mit Krankheit
verlassen werde – frei zum Leben – zum Sterben –
…
so weiß ich ja nicht
was mein Unsichtbares
nun mit mir anfangen wird –
1960 erhält Nelly Sachs den Meersburger Droste-Preis. Erstmals nach 20 Jahren kehrt sie nach Deutschland zurück. Sie fliegt in die Schweiz, um von dort aus zur Preisverleihung zu fahren, um aber nicht zu lange in Deutschland sein zu müssen. Und trotzdem endet diese Reise tragisch. Aris Fioretos sagt, der Droste-Preis sei für sie eine „Glückskatastrophe“ gewesen. Nach der Wiederbegegnung mit Deutschland, dem „geliebten und gefürchteten Land“ verstärkt sich die psychische Erkrankung noch mehr. Sie muss für lange Zeit in eine Klinik. Aber in der Schweiz trifft sie Paul Celan im Hotel Zum Storchen. Wie bei ihm fiel die wachsende Anerkennung auch bei Nelly Sachs „mit dem Gefühl zunehmender Verfolgung zusammen“, sagt Fioretos. Paul Celan schreibt ihr in die Klinik folgendes Gedicht:
ZÜRICH, ZUM STORCHEN
Für Nelly Sachs
Von deinem Gott war die Rede, ich sprach
gegen ihn, ich
ließ das Herz, das ich hatte,
hoffen: auf
sein höchstes, umröcheltes, sein
haderndes Wort –
Dein Aug sah mir zu, sah hinweg,
dein Mund
sprach sich dem Aug zu, ich hörte:
Wir
wissen ja nicht, weißt du,
wir
wissen ja nicht,
was
gilt.
Nelly Sachs bekam auch den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und wurde kurz vor ihrem Tod Ehrenbürgerin von Berlin. Aber Hilde Domin sagt, je mehr sie geschätzt wurde, um so mehr wurde sie „ent-einsamt“.
Es gibt Zufälle, die es nicht geben dürfte. Wahrscheinlich starb Celan am 20. April in der Seine. Aber was sicher ist: am 12. Mai 1970 war seine Beerdigung in Paris. Am selben Tag starb in Stockholm Nelly Sachs.
Kommt einer von ferne
Kommt einer
von ferne
mit einer Sprache
die vielleicht die Laute
verschließt
mit dem Wiehern der Stute
oder
dem Piepen
junger Schwarzamseln
oder
auch wie eine knirschende Säge
die alle Nähe zerschneide
…
Ein Fremder hat immer
seine Heimat im Arm
…
Das alles gehört bei Nelly Sachs zu dem kurzen Wort Exil. Und sie ist nur eine von 500 000 Deutschen, die von den Nazis aus Deutschland hinaus vertrieben wurden.
Auf einer Porzellantafel lässt sich nicht erklären, dass man Freiwild war, dass man die Verzweiflung von einem Versteck ins andere trug, dass der gute oder böse Zufall Schicksal spielte. Und dass man auch im guten Zufall mit kaputten Nerven in einer aussichtslosen Fremde ankam. Dass man arm und einsam „gerettet“ war, ohne Kraft für Hoffnung, umgeben von der eigenen Verlorenheit.
Es gibt mittlerweile ein Museum für die Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten nach Deutschland hinein – das Museum der Heimatvertriebenen. Aber sie waren die zweiten Heimatvertriebenen. Die ersten Heimatvertriebenen waren die aus Deutschland hinaus Gejagten. War Deutschland nicht ihre Heimat? Wurden nicht auch sie vertrieben?
Wenn wir heute über Exil reden, reden wir immer noch über diese Leerstelle in der deutschen Erinnerungskultur. Die Handfläche der Stolpersteine und das Mundtuch der Porzellantafeln sind zu klein, um die Dimensionen des Exils zu zeigen. Wir brauchen dafür das Exilmuseum am Anhalter Bahnhof. Wir brauchen es für das Exil von damals und genauso für das Exil von heute. Denn solang es Diktaturen gibt, gibt es Flucht und Exil. Immer wieder neu. Indem wir an das Exil von damals erinnern, lernen wir Anteilnahme für das Exil von heute. So gesehen ist das Exilmuseum von sich aus auch ein Museum der Gegenwart.
Foto: © David Ausserhofer
Stiftung-exilmuseum.berlin