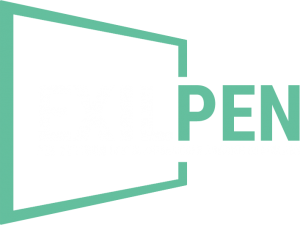Heimat haben und Welt – Reiner Kunze wird 90 Jahre alt
Von MARKO MARTIN
Reiner Kunze, geboren 1933 im erzgebirgischen Oelsnitz als Kind einer Arbeiterfamilie, war zeitlebens von fragiler physischer Konstitution. Dass er heute in Obernzell-Erlau bei Passau seinen 90. Geburtstag feiern kann, ist deshalb ein großes Glück. Wie ohnehin Daseinsdankbarkeit sein umfangreiches lyrisches, essayistisches und Übersetzungs-Werk durchzieht – übrigens im puren Kontrast zum Zerrbild des „verbitterten Renegaten“, das vor allem in den achtziger Jahren sich links wähnende Ideologen verbreitet hatten.
Reiner Kunze war im Jahr 1977 aus der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelt, nachdem er aus dem ostdeutschen Schriftstellerverband herausgeworfen worden war und die manifesten Partei- und Stasidrohungen gegen den Autor der „Wunderbaren Jahre“ zugenommen hatten. Der stille Dichter als plötzlich ungemein erfolgreicher, ja sogar verfilmter Prosa-Autor: Das missfiel damals auch so manchen im Westen, welche die lakonischen und häufig sogar poetischen (DDR-Jugend-) Geschichten in jenem Buch für besonders abgefeimte „Kalte Kriegs-Propaganda“ hielten. Um so wichtiger, heute noch einmal daran zu erinnern, wer damals Reiner Kunze u.a. beistand: Heinrich Böll in seiner wunderbar sensiblen Laudatio zum Georg-Büchner-Preis, der engagierte HR-Radioredakteur und Robert-Musil-Experte Karl Corino – und der seinerzeitige „Welt“-Redakteur Lothar Schmidt-Mühlisch, der die damalige Literaturbeilage „Geistige Welt“ den vertriebenen DDR-Autoren öffnete.
Zum Anlass des Geburtstages hat nun S. Fischer, Reiner Kunzes getreue verlegerische Heimstatt seit vielen Jahrzehnten, eine schöne Ausgabe der gesammelten Gedichte herausgebracht und dazu auch die „Wunderbaren Jahre“ neu aufgelegt. Und siehe da: Die ruhige, unaufgeregte Stimme des Chronisten, der da von ideologischer Zurichtung und individueller Renitenz berichtet, von Schmerz und Momenten unerwarteter Schönheit, spricht noch heute zu uns. Und kann dann sogar – ebenso wie die Prosa-Miniaturen von Kunzes zwei Jahrzehnte jüngerem, doch bereits 1999 an einem ominösen Blutkrebs verstorbenen engen Kollegenfreund Jürgen Fuchs – beunruhigend Gegenwärtiges zu erklären helfen, will heißen die aus rigider DDR-Verdrängung und anerzogener Empathielosigkeit eben auch resultierenden AfD-Erfolge im Osten Deutschlands.
Doch wo bliebe dann das Glück? „Jeder tag/ ist ein brief// Jeden abend/ versiegeln wir ihn// Die nacht trägt ihn fort// Wer empfängt ihn“. Gewidmet ist dieses frühe Gedicht aus den sechziger Jahren seiner Frau und großen Lebensliebe Elisabeth, ohne die – das ist keine Übertreibung – Reiner Kunzes Leben und Werk kaum vorstellbar wäre. Im Jahr 1961 hatte die tschechische Ärztin Elisabeth Littnerová in der deutschsprachigen Literatursendung von „Radio Prag“ erstmals Kunzes Gedichte gehört und sich auf diesem Weg in ihn verliebt. Die bis zum heutigen Tag andauernde Symbiose der beiden – öffentlich auch wahrnehmbar in der „Elisabeth-und-Reiner-Kunze-Stiftung“, die sich u.a. der Förderung junger Künstler und Künstlerinnen verschrieben hat – ist dabei alles andere als Selbstverkapselung.
Nicht zuletzt seiner Frau verdankt Reiner Kunze eine intime Kenntnis der tschechischen Poesie – und seine Leser wunderbar kongeniale Übersetzungen des 1989 verstorbenen mährischen Poeten Jan Skácel. Deshalb beinahe zwingend, dass er nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 aus der SED ausgetreten und in den Augen der Machthaber damit vollends zu jenem „feindlichen Dichter“ geworden war, als den ihn die bis nach Mauerfall ´89 fortgeführte Stasi-Observationsakte „Lyrik“ beschrieb.
Dabei ist Reiner Kunze bis heute ein Autor der „Zimmerlautstärke“ (so der Titel eines seiner Gedichtbände), der statt lautstarker Rhetorik auf die sanfte, mitunter beklemmende Stärke des Bildes vertraut, dabei jedoch auch die Konklusion nicht scheut. Zum Beispiel in „Erster Brief der Tamara A.“, aus dem Jahr 1969, der sich inzwischen wieder ungeahnt aktuell liest: „Geschrieben habe dir/ Tamara A., vierzehn jahre alt, bald/ mitglied des Komsomol// In ihrer stadt, schreibe sie, stehen/ vier denkmäler:/ Lenin/ Tschapajew/ Kirow/ Kuibyschew// Schade, daß sie nichts erzähle/ von sich// Sie erzählt/ von sich, tochter“
Kein Zufall angesichts all der erfahrenen und präzis beschriebenen Beengungen und Bedrängungen (auf die das heutige Modewort „systemisch“ nun tatsächlich zuträfe), dass quasi als Antidot das Wort „welt“ in Reiner Kunzes Gedichten immer wieder auftaucht und seine poetische Kraft entfaltet – an einem Sonntagnachmittag in Porto, in den sonnenhellen Straßen von Marseille, an der Klagemauer in Jerusalem, in Namibia (wo auch ein eindrucksvoller Fotoband entstand) oder in den filigranen Landschaften Japans und Südkoreas.
Es ist als wäre ein einziges Aufatmen in diesen im Westen Deutschlands entstandenen Zeilen. Die freie Gesellschaft mag zwar die Tragik unserer Endlichkeit und persönlicher Schicksalsschläge nicht zu bannen – und töricht wäre es, so Kunze in seinen raren, aber stets punktgenauen publizistischen Wortmeldungen, sie mit solchen Wünschen zu überfrachten. Doch bietet sie die institutionell beschirmte Chance auf ein gelingendes Leben zuvor. Im Gedicht „In Salzburg, Auf dem Mönchsberg stehend (nach ankunft im westen Europas)“ heißt es: „Wiederzukehren/ hierher, können von nun an mich hindern/ armut nur, krankheit/ und tod// Im kupferlaub der dächer geht der blick/ den abend ab// Heimat haben und welt/ und nie mehr der lüge/ den ring küssen müssen“
Eine Gestimmtheit, die Kunze gerade von jenem juste milieu, das heute nicht genug gegen „antidemokratischen Populismus“ wettern kann, einst den Vorwurf eingetragen hatte, er habe “sich angepasst“. Über die Freiheitsverächter aber hatte er bereits damals geschrieben, da er sie jeglicher Couleur „Auf dem Vormarsch“ sah: „erst fassen sie fuß, dann/ nach den köpfen// (Hindert sie die schwelle, kehren sie/ die reihenfolge um)“ Während dann die Ukraine-Gedichte in seinem vorerst letzten, 2018 erschienenem Band „die stunde mit dir selbst“ die russischen Propaganda-Lügen nach der Krim-Annektion wortgenau sezieren und gleichzeitig die Erinnerung an Rose Ausländer und Paul Celan in Czernowitz wachrufen.
Und immer wieder: Musik und Poesie, doch keine Religion als transzendentaler Halt. Dennoch, es gibt die „Möglichkeit, einen Sinn zu finden“: „Durch die risse des glaubens schimmert/ das nichts// Doch schon der kiesel/ nimmt die wärme an/ der hand“
Ein Kiesel – und dazu Silben, geradezu gesetzt wie Fugen: „Unser alter/ ist das alter, das, vom glauben nicht ergriffen,/ das wort, das war im anfang, ehrt“
Wie bei kaum einen anderen Dichter ist bei Reiner Kunze Welt zum Wort geworden, zur großherzigen Einladung und, natürlich, zum vertrauten Zwiegespräch wie in „Haiku für uns“: „blütenblatt im haar/ kirschbaumweiß auf greisenweiß,/ frühling, unsichtbar“. Wünschen wir gerade deshalb Reiner und Elisabeth Kunze weiterhin noch viel gute, gemeinsame Zeit.